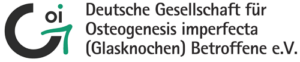Kinder- und Jugendliche:
Dr. Heike Hoyer-Kuhn und Prof. Jörg Oliver Semler sind beide als Fachärzte für Kinderheilkunde an der Universitätsklinik Köln tätig. Beide behandeln seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche mit Osteogenesis imperfecta (OI). In Ihrem Artikel Osteogenesis imperfecta: Neues zur Pathogenese und Therapie, der in der Zeitschrift Pädiatrie – Kinder- und Jugendmedizin hautnah erschienen ist, widmen sie sich ausführlich dem Krankheitsbild der OI und berichten dezidiert über die Behandlungsmöglichkeiten. Der Artikel schließt mit einem Fragebogen, der nicht nur Fachleuten deutlich macht, wie komplex eine Osteogenesis imperfecta auf die unterschiedlichsten Bereiche des Körpers wirken kann.
Den ungekürzten Artikel im PDF-Format finden Sie hier.
(Quelle: pädiatrie hautnah; Jg. 25 (2013), Heft 1, S. 28–34.)
Artikel und Konsensuspapier des Experten-Panels:
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums wurde vom Bundesverband der Deutschen Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta Betroffene e. V. (DOIG) im Juni 2014 ein Experten-Panel einberufen. Im Rahmen einer Zusammenstellung persönlicher Erfahrungen und der Ergebnisse einer Literaturrecherche formulierten die Teilnehmenden aus den Bereichen Pädiatrie, Anästhesie, Orthopädie, Allgemeinmedizin und Pulmologie Statements zur medizinischen Betreuung von Menschen mit Osteogenesis imperfecta (OI) im Alter von 0 bis 18 Jahren. Diese werden im vorliegenden Beitrag zusammengefasst.
Der Artikel ist frei zugänglich. Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Springer Medizin Verlages. Zum Artikel und zum Konsensus-Papier geht es hier.
Übersichtsartikel zur Rehabilitation von Erwachsenen mit OI:
Ein Autorenteam von der Klinik DER FÜRSTENHOF in Bad Pyrmont hat die Grundlagen seiner Rehabilitationskonzepte in Form eines Artikels zusammengefasst, der in der Zeitschrift für Rheumatologie erschien.
Die beiden Chefärzte Dr. Martin Gehlen (Rheumatologie und Osteologie) und Christian Hinz (Orthopädie und Osteologie) werden in bei der Behandlung von Menschen mit OI insbesondere von Dr. Ana Doina Lazarescu (Osteologin) und Dr. Michael Pfeifer (osteologisches Forschungsinstitut der Klinik) unterstützt.
Der Beitrag beschreibt die wichtigsten klinischen Manifestationen der OI und die Einteilung anhand des Phänotyps, die wichtigsten zugrunde liegenden genetischen Ursachen und ihre Vererbungsmodi sowie die wichtigsten Elemente einer multimodalen Therapie im Rahmen einer spezialisierten Rehabilitation. Der Artikel ist außerdem eine zertifizierte Fortbildungseinheit für Ärztinnen und Ärzte (CME).
Die DOIG freut sich, dass auch ihre Arbeit erwähnt wird: „Was in der Selbsthilfe geleistet wird, ist eine unverzichtbare Ergänzung zu unseren stationären Behandlungen und hilft, den Therapieerfolg sicherzustellen“, betont Martin Gehlen am Telefon. In einer subjektiven Einschätzung stellt das Autorenteam abschließend fest, dass regelmäßige Reha-Maßnahmen in Abstand von ein bis zwei Jahren oft den Verbleib im Erwerbsleben ermöglichen und regelmäßige Arbeit mit sozialer Anerkennung verbunden ist – beides gesundheitsfördernde Faktoren.
Der Artikel „Rehabilitation seltener Erkrankungen im Erwachsenenalter: Osteogenesis imperfecta“ erschien erstmals in der Zeitschrift für Rheumatologie (Nr. 80, Jahrgang 2021, S. 29–42) und ist mit freundlicher Genehmigung des Springer Medizin Verlags hier abrufbar.
Ein weiterer Artikel, eine Einzelfalldarstellung, die die Autoren zusammen mit einer OI-Betroffenen erstellt haben, ist in Vorbereitung und wird in der Fachzeitschrift „Die Rehabilitation“ erscheinen.
Zähne und Kiefer:
Zahnärztinnen und Zahnärzte können sich bei der Behandlung von seltenen, genetisch bedingten Zahnerkrankungen jetzt erstmals auf eine S3-Leitlinie stützen. Ein vom Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gefördertes Projekt hat die evidenzbasierten Empfehlungen (entsprechend des Regelwerks der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF, mehr dazu weiter unten) neu entwickelt. Auch eine begleitende Patienten-Leitlinie wurden entwickelt.
Bislang fehlten systematisch entwickelte Behandlungsempfehlungen, obwohl Betroffene von früher Kindheit an und lebenslang eine zahnärztliche Betreuung benötigen, denn mögliche Befunde können z. B. fehlender oder gestörter Zahnschmelz, vorzeitiger Zahnverlust oder die Nichtanlage von Zähnen sein. Diese Lücke wird nun durch die erfolgreiche neuentwickelte S3-Leitlinie geschlossen.
Darin werden die seltenen, genetisch bedingten Zahnerkrankungen anhand der Leitsymptome gebündelt, optimale Behandlungsstrategien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene beschrieben sowie neue, digitale Fertigungstechnologien bei der prothetischen Versorgung beurteilt. Die Leitlinie gilt für Betroffene ohne bzw. mit Syndromen bzw. Komorbiditäten. Die Leitlinie soll Betroffenen bzw. Eltern/sorgeberechtigten Personen als Orientierungs- und Entscheidungshilfe dienen.
Federführende Fachgesellschaften sind die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund und Kieferheilkunde (DGZMK), für Prothetische Zahnmedizin (DGPro), für Humangenetik e. V. (GFH) und für Kinderzahnheilkunde e. V. (DGKiZ).
Die Deutsche Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta (Glasknochen) Betroffene e. V. (DOIG) hat als beteiligte Fachgesellschaft/Organisation die Patienteninteressen vertreten, namentlich war Claudia Finis hier im Einsatz. Zu den Symptomen der Osteogenesis imperfecta kann die ebenfalls genetisch bedingte Dentinogenesis imperfecta (DI) gehören, bei der das Dentin, also die Zahngrundsubstanz, gestört ist.
Als Adressaten der Leitlinie gelten Betroffene von seltenen Erkrankungen der Zähne, angewendet werden sie vonZahnärzte, Fachzahnärzte, dem zahnmedizinischen Fachpersonal sowie Angehörigen der Gesundheitsberufe, die an der Diagnostik und Versorgung der genannten Betroffenengruppe beteiligt sind.
Die Leitlinie erstreckt sich ausschließlich auf den Versorgungsbereich der primär-zahnärztlichen, ambulanten Versorgung.
Das S steht beim S-Klassifikationsschema für das Ausmaß der angewandten Systematik bei der Entwicklung der Leitlinie. Die 3 ist die höchste Klassifikation und verweist auf alle Elemente einer systematischen Entwicklung und auf die Vertretenden von Fachgesellschaften und Organisationen, inklusive Patienten und Patientinnen, die frühzeitig eingebunden werden.
Mehr Informationen: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/083-048
Claudia Finis und mit ihr die DOIG hoffen, dass Prof. Dr. Jan Kühnisch, einer der beiden Projektkoordinatoren, bei seinem Vorhaben bleibt und weiter die Absicht verfolgt, für Betroffene bessere Konditionen bei der Kostenübernahme zu erkämpfen. Die DOIG wird diesen Prozess nach Kräften unterstützen.