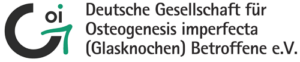Durchbruch 04/21
Inhaltsverzeichnis LeseprobenHerbstzeit ist Lesezeit! Mit besonderem Stolz stellen wir deshalb neue Titel vor – von unseren schreibenden und veröffentlichenden Mitgliedern. Initiative einzigartig: Eine Kampagne sorgt für Aufmerksamkeit für OI – und für […]
Durchbruch 03/21
Inhaltsverzeichnis Leseprobe:Jasmin Hasshold berichtet, wie sie ihr Auslandssemester in Lyon organisiert hat, und Irmgard Wandt und Hans-Peter Stavenhagen erzählen von ihrem ihren barrierefreien Urlaub an der Algarve. DOIG-Mitglieder erhalten die Ausgabe […]
… der neue Durchbruch ist da (02/21)
… und das steht drin: Inhaltsverzeichnis Leseproben: Rebecca Maskos über Ablesimus: Warum Ableismus Nichtbehinderten hilft, sich normal zu fühlen Gastbeitrag des bbe e. V. – Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern: Menschen […]
Berufliche Teilhabe: REHADAT-Adressen
Das Portal REHADAT-Adressen wurde überarbeitet und ist nun online: in neuem Layout, mit erweiterten Inhalten und optimiert für mobile Endgeräte. Nutzerinnen und Nutzer finden nach Themen sortiert über 13.000 Dienstleister, […]
Online-Befragung zur Corona-Pandemie
Noch bis zum 30. April besteht die Möglichkeit, an der Online-Befragung “Gesundheit und Gesundheitskompetenz von Menschen mit Beeinträchtigung während der Corona-Pandemie” (COVID-HL-HeHLDiCo) zu beteiligen. Die Befragung wird im Zusammenhang mit der […]
… der neue Durchbruch ist da (01/2021)
… und das steht drin: Leseprobe: Interview mit der finnischen Textil-, Konzept- und Performance-Künstlerin Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen.Die Redaktion wünscht gute Lektüre! Neugierig geworden?Sie wollen mehr lesen und sind noch kein Mitglied? Das […]
Mutmachen zum Rare Disease Day (28. Februar)
Gerne veröffentlichen wir einen Aufruf unserer Dachorganisation ACHSE zum Rare Disease Day, dem Internationalen Tag der Seltenen Erkrankungen, am 28. Februar 2021: WAS MACHT SIE STARK – IN DIESEN ZEITEN […]
Bewältigungsstrategien: Leitfaden für Eltern
Unsere Beauftragte für Gesundheitspolitische Fragen, Claudia Finis, hat eine wichtige Nachricht und wertvolle Information für Eltern von OI betroffenen Kinder: Ein gesundes, friedliches neues Jahr wünsche ich Allen. Im letzten […]
Dr. Peter Radtke: „Kunst und Rehabilitation“
Dr. Peter Radtke, kürzlich verstorbener Gründer und Ehrenmitglied der DOIG, hielt anlässlich der Eröffnung der REHA 93, der Düsseldorfer Rehabilitations-Fachmesse, am 6. Oktober 1993 einen Vortrag zum Thema „Kunst und […]
Dr. P. Radtke: “Sand im Getriebe der Welt”
Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Deutschen OI-Gesellschaft hielt der im November 2020 verstorbene Dr. Peter Radtke 1994 in Mauloff eine Rede, die 20 Jahre später in der Sonderausgabe unsere Mitgliedszeitschrift […]